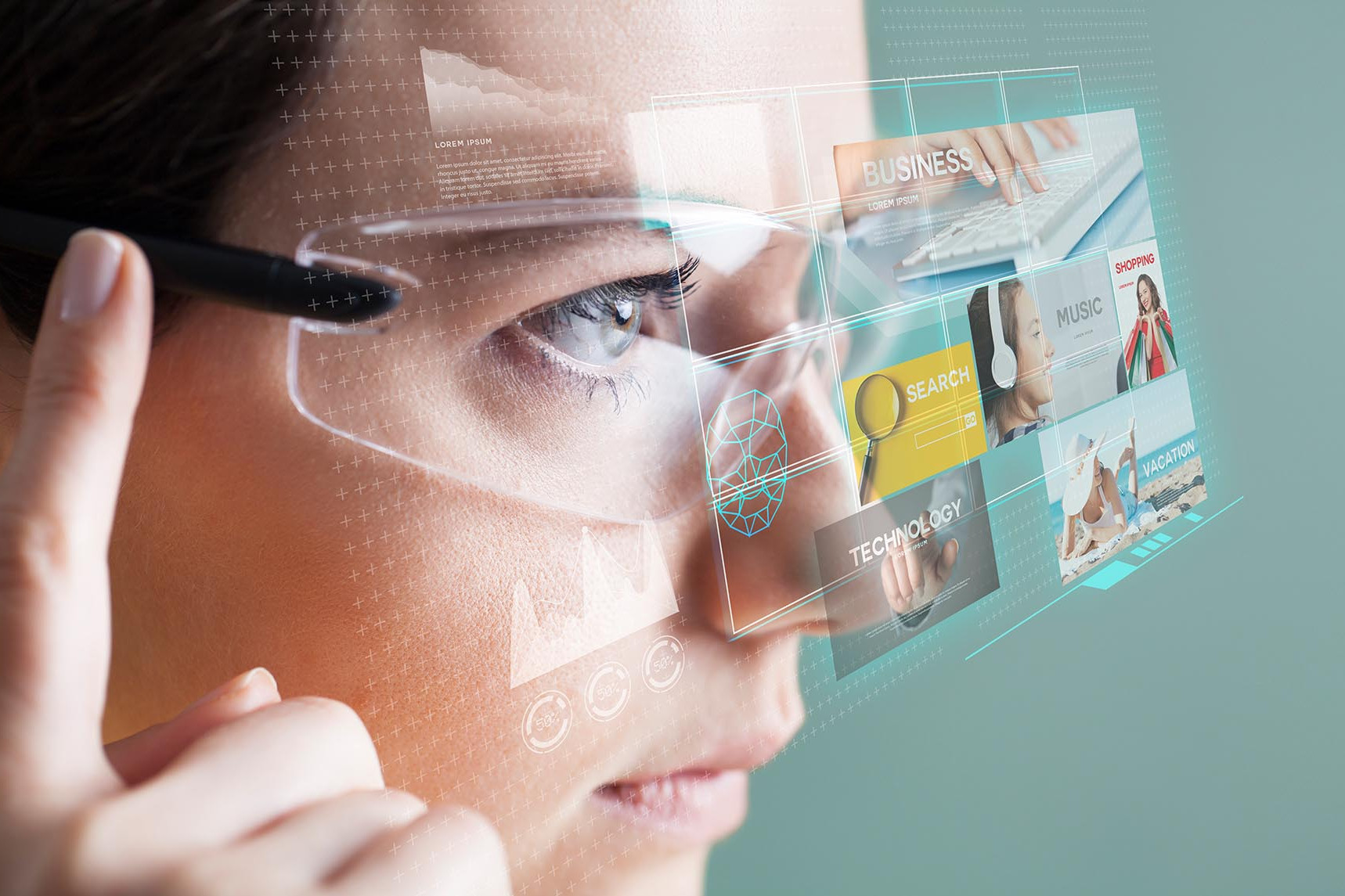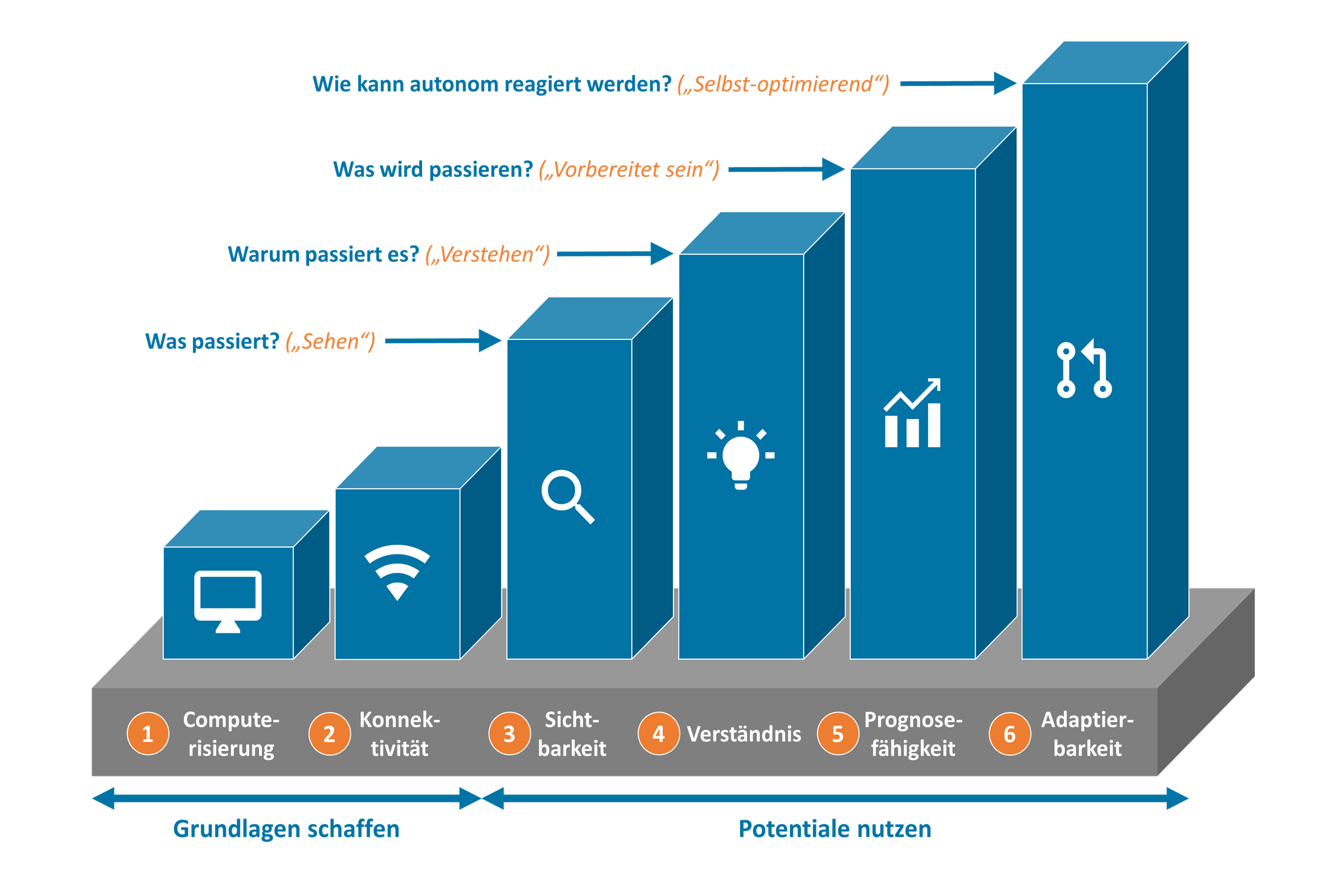BIM beschreibt eine kooperative Arbeitsmethodik, bei der auf der Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks die für seinen gesamten Lebenszyklus (Planung, Bau, Betrieb, Rückbau) bis hin zu dessen Bewirtschaftung relevanten Informationen und Daten konsistent digital erfasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten (Auftraggeber, Architekten, Ingenieure, Handwerk, Bauwirtschaft, Aufsichtsbehörden, Betreiber etc.) ausgetauscht oder für die weitere Bearbeitung übergeben werden. Das dabei entstehende digitale Gebäudemodell enthält alle wichtigen Informationen zum Bauwerk über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
BIM ermöglicht damit eine integrale Planung und eine ganzheitliche Herangehensweise, bei der die unterschiedlichen Fachdisziplinen, die an den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes beteiligt sind, miteinbezogen werden können und Zugriff auf alle Phasen des Lebenszyklus des Gebäudes erhalten. Die entstehende Transparenz kann ungenutzte Effektivitäts- und Effizienzreserven erschließen, z. B. die Vermeidung von Missverständnissen, die Verkürzung von Planungs- und Genehmigungsverfahren oder durch die Ausnutzung industrieller Vorfertigung von Komponenten und Modulen (analog z. B. dem Anlagenbau). Darüber hinaus bietet die Lebenszyklus-Betrachtung auch fundierte Information über die ökologische Performance eines Gebäudes. Der Schlüssel für den Erfolg von BIM ist dabei ein Workflow der digitalen Daten über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, von der Planung über die Bauausführung, dem Ausmaß sowie die Abrechnung und Bewirtschaftung, ggf. vorzunehmende Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen bis hin zum Rückbau des Bauwerks. Erst wenn dieser Workflow durchgängig gesichert ist, kommen die Vorteile von BIM zum Zuge. Während größere Planungsgesellschaften BIM mehr oder weniger integriert bereits seit Jahren nutzen (CAD (computer aided design) als planungsorientierte Anwendung), sind viele kleine und mittlere Unternehmen, gleich welche Stakeholder, bislang zu BIM noch nicht in der Lage.
Des Weiteren gibt es Ansätze BIM mit dem Geographischen Informationssystem (GIS) zu verbinden und so die Objektmodelle von Gebäuden und Infrastrukturdaten mit den dazugehörigen Umgebungsdaten zu verknüpfen. Durch die Verbindung wird dem BIM-Modell eine raumbezogene Kontextebene dazu gefügt, die es ermöglicht funktionale Wechselwirkungen und Zusammenhänge herstellen, zu analysieren und zu bearbeiten.
Sowohl das BMVI wie auch das BMUB setzen sich dafür ein, das BIM bei neuen Bauprojekten verstärkt angewendet wird. Ab Ende 2020 soll laut dem Stufenplan des BMVI zur Implementierung digitaler Planungsmethoden bei öffentlichen Projekten BIM grundsätzlich zum Einsatz kommen. Vor dem Hintergrund wird zurzeit geprüft, inwieweit dafür Änderungen in den bestehenden Gesetzen (z.B. Vergaberecht) erforderlich sind.
Weitere Informationen zum Thema Building Information Modeling finden Sie im Dokument „Nutzungsmöglichkeiten der Digitalisierung“, das im Mitgliederbereich als PDF Download zur Verfügung steht.